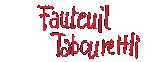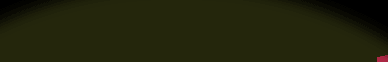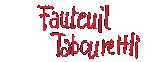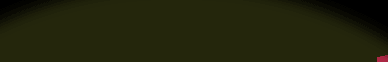|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 baute der mittlerweile
weltberühmte spanische Architekt Santiago Calatrava das Tabourettli
zu einem "Cabaret mit Konsumation", um. Seither
trägt das Theater im ersten Stock die - zugegeben inoffizielle - Bezeichnung
"Europas schönstes Kleinkunsttheater".
|
|
|
|
|
|
|
Nachdem sich die Verantwortlichen
der Stadt Basel zu Beginn der Neunziger Jahre aus Kostengründen gegen
den geplanten Neubau der Wettsteinbrücke durch Santiago Calatrava
entschieden haben, bleibt das Tabourettli das vorläufig einzige
Basler Werk des genialen spanischen Architekten. Jährlich lockt es
ganze Scharen von Architektur interessierten Gästen aus der ganzen
Welt in das kleine Theater am Spalenberg. |
|
|
Fotos vom Fauteuil,
Tabourettli und Kaisersaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aus dem Bericht der Denkmalpflege
"Der Spalenhof in Basel gehört zu den wichtigsten profanen Baudenkmälern
der Stadt. Er stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde im 15. und
16. Jahrhundert zu einem repräsentativen Kaufmannssitz ausgebaut.
Der Skelettbau war in der Mitte stark eingesunken, der Dachausbau
brachte neue Belastungen für die gesamte Statik, und die Theaternutzung
erforderte eine akustische Isolierung hohen Ausmasses.
Nach vielen Projekten wurde der Vorschlag Santiago Calatravas ausgeführt:
Ein auf die Längsachse des Hauses ausgerichteter Fachwerkträger im
obersten Geschoss ruht auf einem Bock, der die Treppe zum darunterliegenden
Theaterraum des "Tabourettli" bildet. An ihm ist der grosse Saal in
Umkehrung der Kräfte aufgehängt. Diese statische Lösung ermöglicht
es, die Verluste an historischer Bausubstanz gering zu halten. Um
den Treppenbock hat Calatrava das Entree, im gotischen Zimmer das
Foyer und unter dem grossen Saal selbst - an einer Stelle, an der
das statische Gefüge gestört war - das Theater "Tabourettli" eingerichtet.
Hier durchdringen sich alte Bausubstanz und neue, organische Formen
assoziieren Elemente in eigenwilliger Weise." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notizen Santiago Calatravas
"Zunächst wurden wir um eine Beratung in statischen Fragen des Umbaus
gebeten; wir sollten die Tragstruktur des Gebäudes prüfen, welches
fast kein Fundament hatte. Eine Alternative war es, neue Elemente
mit den alten Strukturen zu vermischen; dies würde dem Gebäude eine
Tragstruktur geben. Dagegen hatten wir die Idee einer Treppenbrücke;
sie fasst alle Lasten in einer kräftigen Stütze zusammen, welche neben
den alten Teilen entlang führt und so jede Notwendigkeit schwerer
Tragelemente vermeidet. Auf diese Weise wirkt die Treppenbrücke zweifach:
als neues Erschliessungselement und als Tragwerk zum Ableiten der
Kräfte in das Mauerwerk des Gebäudes."
Zur Gestaltung des Tabourettli hielt Calatrava folgendes fest:
"Es sind drei Räumlichkeiten, aus deren Reihenfolge das Cabaret-Theater
entstand. Das Foyer und das Treppenhaus bilden die erste Räumlichkeit.
Garderobe und Treppe sind aus Stahl und Glas konstruiert. Das Pausenfoyer,
das als nächste Räumlichkeit folgt, ist aus einer gotischen Stube
entstanden, in der man eine verspiegelte hölzerne Garderobe installiert
hat. Der Saal wurde so umgebaut, dass drei vorhandene Säulen entfernt
wurden. Dies erforderte eine Aufhängung der Deckenkonstruktion, deren
Lasten auf das stählerne Treppenhaus umgeleitet wurden und somit zur
Hälfte auf diesem ruhen.
Die Stahlkonstruktion hat die Aufgabe, einerseits die Last von ca.
211 Tonnen in die Fundamente abzuleiten, andererseits einen Treppenaufgang
für das Cabaret-Theater Tabourettli und ein Verbindungspodest zwischen
dem Foyer und dem eigentlichen Theater zu schaffen. Für die Inneneinrichtung
wurden Möbel, Tische, Hocker und Lampen entworfen." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
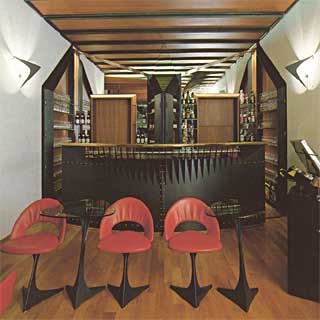 |
|
|
|
|
|
|
|
Die Bar des Tabourettli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beurteilung von Calatravas
Werk
"Santiago Calatravas Werk spannt den Bogen vom Ingenieurbau über die
Architektur bis zum Innenraum und zum Design als Kunstwerk. Neue Tendenzen
im Innerräumlichen werden aufgespürt. Konstruktive Elemente und ökonomische
Fragen werden gleichermassen durchdacht. Der räumliche Zusammenhang,
der Übergang vom einen Material in das andere zeichnet die materialbetonte
Architektur aus."
Werner Blaser, in "Stahl und Form", 1991. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|